FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Thema „häusliche Pflege“
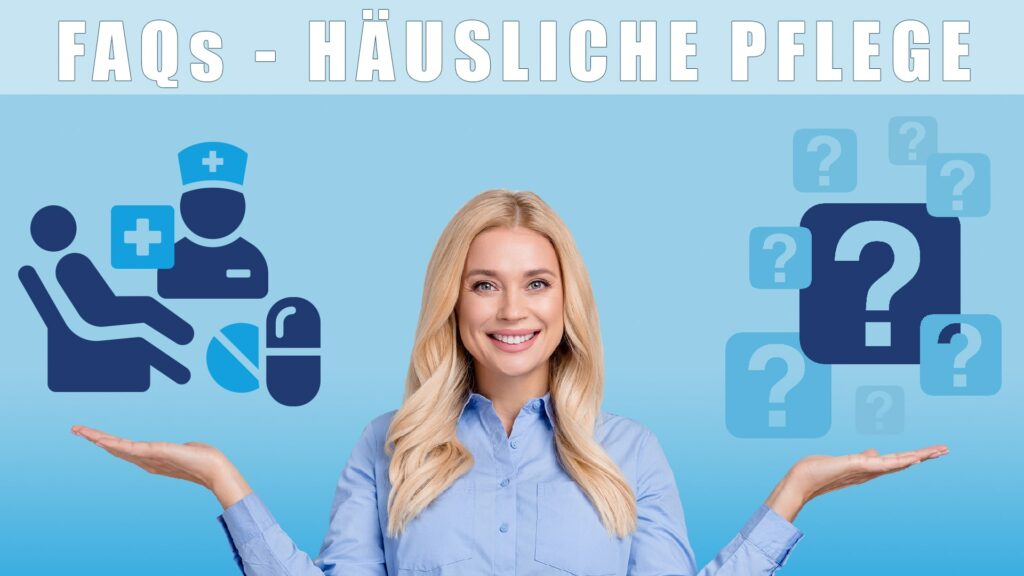
Allgemeines zur häuslichen Pflege:
Formen der häuslichen Pflege
- Angehörigenpflege / informelle Pflege:
- Die Pflege wird überwiegend von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten übernommen.
- Diese Form ist in Deutschland die häufigste.
- Pflege durch ambulante Pflegedienste:
- Professionelle Pflegekräfte kommen regelmäßig ins Haus und übernehmen Aufgaben wie Körperpflege, Medikamentengabe oder Verbandswechsel.
- Häufige Kombination mit Angehörigenpflege.
- 24-Stunden-Betreuung:
- Eine Betreuungsperson (oft aus dem Ausland) lebt mit im Haushalt und übernimmt Pflege und hauswirtschaftliche Aufgaben.
- Wichtig: rechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte beachten.
Leistungen im Rahmen der häuslichen Pflege
Je nach Pflegegrad und Bedarf kann die Pflege Folgendes umfassen:- Grundpflege (Waschen, Anziehen, Ernährung)
- Hauswirtschaftliche Versorgung (Einkaufen, Kochen, Putzen)
- Medizinische Behandlungspflege (z. B. Injektionen, Verbände – nur durch Fachpersonal)
- Betreuung und Begleitung im Alltag
Finanzielle Unterstützung
Die Pflegeversicherung zahlt je nach Pflegegrad und Pflegeform:- Pflegegeld bei Pflege durch Angehörige
- Pflegesachleistungen bei Pflege durch Pflegedienste
- Kombinationsleistungen, wenn beide kombiniert werden
- Zusätzliche Zuschüsse für Hilfsmittel, Wohnraumanpassung (Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen für die Pflege nach § 40 Abs. 4 SGB XI) oder Verhinderungspflege
Ziel der häuslichen Pflege
Menschen mit Pflegebedarf sollen trotz Einschränkungen so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben können – mit Unterstützung, aber in Würde und größtmöglicher Selbstbestimmung.Häusliche Pflege kann von verschiedenen Personen oder Einrichtungen angeboten werden – je nach Bedarf, Pflegegrad und finanziellen Möglichkeiten. Hier sind die wichtigsten Anbieter:
🧑👩👦 1. Angehörige oder Freunde
Wer? Familienmitglieder, Nachbarn, Bekannte
Merkmale:
Häufigste Form der Pflege in Deutschland
Meist unentgeltlich oder gegen Pflegegeld (von der Pflegekasse)
Persönlich und emotional eng verbunden
🏥 2. Ambulante Pflegedienste
Wer? Professionelle Pflegedienste mit examinierten Pflegekräften
Merkmale:
- Erbringen Pflegesachleistungen wie Körperpflege, Medikamentengabe, Wundversorgung
Vertragspartner der Pflegekassen
Abrechnung direkt mit der Pflegekasse möglich
Einsatzzeiten nach Vereinbarung, meist stundenweise
🧑⚕️ 3. Selbstständige Pflegekräfte
Wer? Freiberufliche Pflegekräfte (in Deutschland zugelassen)
Merkmale:
Selten, da rechtlich und organisatorisch aufwendiger
In der Regel nur für bestimmte Leistungen einsetzbar (z. B. Betreuung, seltener für medizinische Pflege)
🛏️ 4. 24-Stunden-Betreuungskräfte (häufig aus dem Ausland)
Wer? Betreuungskräfte, meist über Agenturen vermittelt (z. B. aus Polen, Rumänien)
Merkmale:
Wohnen mit im Haushalt der pflegebedürftigen Person
Übernehmen Betreuung, hauswirtschaftliche Aufgaben, teilweise Grundpflege
Keine medizinische Pflege
Oft in Verbindung mit einem Ambulanten Pflegedienst
🧓 5. Ehrenamtliche Helfer / Nachbarschaftshilfe
Wer? Freiwillige, z. B. aus Seniorenbüros, Nachbarschaftsinitiativen, Kirchen
Merkmale:
Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben, soziale Betreuung
Keine professionelle Pflege
Oft ergänzend zur Angehörigen- oder Dienstleisterpflege
Wer hat Anspruch auf häusliche Pflege?
In Deutschland haben Menschen Anspruch auf häusliche Pflege, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Pflegeversicherung regelt, wer Anspruch hat und in welchem Umfang.
✅ Voraussetzungen für häusliche Pflegeleistungen:
- Pflegebedürftigkeit: Anerkannter Pflegegrad (1–5) durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof bei Privatversicherten.
- Wohnsituation: Die Pflege findet zu Hause statt – in der eigenen Wohnung, bei Angehörigen oder in betreutem Wohnen.
- Pflege durch Angehörige oder Pflegedienste: Die Pflege kann durch Angehörige, ehrenamtliche Helfer oder ambulante Pflegedienste erfolgen.
🧾 Welche Leistungen gibt es bei häuslicher Pflege?
- Pflegegeld (bei Pflege durch Angehörige)
- Pflegesachleistungen (z. B. durch ambulante Pflegedienste)
- Kombinationsleistungen (Geld + Sachleistung)
- Entlastungsbetrag (131 € monatlich z. B. für Haushaltshilfe)
- Verhinderungspflege (bei Ausfall der Pflegeperson)
- Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege
- Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassung
📌 Wichtig:
- Der Antrag muss bei der Pflegekasse gestellt werden (gehört zur Krankenkasse).
- Die Feststellung des Pflegegrads erfolgt nach einem Hausbesuch und einem Gutachten.
Hinweis: Wenn Sie konkrete Fragen zu einem bestimmten Fall haben – z. B. zur Kombination von Leistungen, zur Beantragung oder zum Pflegegrad – kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wie kann man häusliche Pflege beantragen?
Die Beantragung häuslicher Pflegeleistungen in Deutschland erfolgt in mehreren Schritten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Antrag bei der Pflegekasse stellen
Der erste Schritt ist ein formloser Antrag bei der Pflegekasse der betroffenen Person. Dies kann telefonisch, schriftlich oder online erfolgen. Die Pflegekasse ist der jeweiligen Krankenkasse angegliedert.
2. Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD)
Nach Antragstellung beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst (MD) (bei gesetzlich Versicherten) oder Medicproof (bei privat Versicherten) mit einer Begutachtung der pflegebedürftigen Person – meist durch einen Hausbesuch.
3. Feststellung des Pflegegrads
Basierend auf der Begutachtung wird ein Pflegegrad (1 bis 5) vergeben, der den Umfang der Pflegebedürftigkeit festlegt. Die Pflegekasse informiert anschließend über das Ergebnis.
4. Leistungen auswählen und organisieren
Je nach Pflegegrad können unterschiedliche Leistungen der häuslichen Pflege in Anspruch genommen werden (z. B. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbetrag). Angehörige oder ambulante Pflegedienste können die Pflege übernehmen.
5. Auszahlung oder Unterstützung erhalten
Nach Bewilligung der Leistungen erfolgt entweder eine monatliche Auszahlung des Pflegegelds oder die Organisation der gewünschten Sachleistungen durch Pflegedienste.
💡 Tipp:
Es empfiehlt sich, sich vor der Antragstellung beraten zu lassen – z. B. durch Pflegeberatungsstellen, Pflegestützpunkte oder die Krankenkasse. Diese helfen auch beim Ausfüllen des Antrags.
Pflegevertrag:
Was ist ein Pflegevertrag?
Ein Pflegevertrag ist ein schriftlicher Vertrag zwischen einer pflegebedürftigen Person (oder einer bevollmächtigten Person) und einem ambulanten Pflegedienst.
Er regelt die individuellen Vereinbarungen zu folgenden Punkten:
- Art und Umfang der Pflegeleistungen
- Häufigkeit und Dauer der Pflegeeinsätze
- Kosten und Abrechnungsmodalitäten
- Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen
- Hinweise zu möglichen Zuzahlungen oder Eigenanteilen
Rechtsgrundlage: Pflegeverträge basieren auf § 120 SGB XI. Der Vertrag ist Voraussetzung für die Abrechnung mit der Pflegekasse und dient der rechtlichen Absicherung beider Seiten.
Ein Pflegevertrag schafft Transparenz, Sicherheit und ermöglicht eine klare Leistungsvereinbarung zwischen Pflegebedürftigen und Pflegediensten.
Wie kann man einen Pflegevertrag kündigen?
Ein Pflegevertrag mit einem ambulanten Pflegedienst kann sowohl von der pflegebedürftigen Person als auch vom Pflegedienst unter bestimmten Bedingungen gekündigt werden. Dabei sind Vertragsinhalte, Fristen und rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten.
🔁 Ordentliche Kündigung durch Pflegebedürftige
- Meist mit einer Frist von 14 Tagen möglich
- Die genaue Frist ist im Vertrag festgelegt
- Eine Begründung ist bei regulärer Kündigung nicht notwendig
⚠️ Außerordentliche Kündigung durch Pflegebedürftige
- Sofortige Kündigung möglich bei schwerwiegenden Gründen
- Beispiele: grobe Pflichtverletzung, unzureichende Pflege, Umzug in ein Pflegeheim
- Eine schriftliche Begründung ist empfehlenswert
Tipp: Die Kündigung sollte immer schriftlich erfolgen – mit Datum, Unterschrift und möglichst per Einschreiben oder gegen Bestätigung.
🚫 Wann darf der Pflegedienst kündigen?
Auch der Pflegedienst kann den Pflegevertrag kündigen – allerdings unter besonderen Voraussetzungen:
- Die Kündigungsfrist richtet sich nach dem individuellen Pflegevertrag, oft beträgt sie 14 Tage
- Verbraucherfreundliche Verträge sehen mitunter längere Fristen vor
- Fehlt eine schriftliche Vereinbarung, gelten die gesetzlichen Regelungen
Wichtig: Ohne vertraglich geregelte Kündigungsfrist darf der Pflegedienst theoretisch von einem Tag auf den anderen kündigen. Da jedoch ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Pflegedienst und Pflegebedürftigem besteht – vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant – ist der Pflegedienst verpflichtet, bei einer Kündigung auf die Situation der pflegebedürftigen Person Rücksicht zu nehmen.
Das bedeutet: Der Pflegedienst darf nur dann kündigen, wenn sichergestellt ist, dass der Pflegebedürftige zeitnah einen neuen Pflegedienst beauftragen kann.
In der Praxis ist daher eine Kündigung durch den Pflegedienst eher die Ausnahme und muss gut begründet sowie rechtzeitig angekündigt sein.
Kündigungsfristen für einen Pflegevertrag
Die Kündigungsfristen für Pflegeverträge unterscheiden sich je nach Art der Kündigung und wer sie ausspricht – der Pflegebedürftige oder die Pflegeeinrichtung.👤 Kündigung durch die pflegebedürftige Person
- Ordentliche Kündigung: – Frist: meist 14 Tage – Begründung ist nicht erforderlich
- Außerordentliche Kündigung: – Frist: sofort, bei wichtigen Gründen (z. B. grobe Pflichtverletzung) – Sollte schriftlich und möglichst mit Begründung erfolgen
🏥 Kündigung durch den Pflegedienst
- Ordentliche Kündigung: – Frist laut Vertrag, häufig ebenfalls 14 Tage – In verbraucherfreundlichen Verträgen auch längere Fristen vorgesehen
- Außerordentliche Kündigung: – Sofortige Kündigung möglich bei schwerwiegendem Verhalten (z. B. Bedrohung, Pflege in Gefahr, Zahlungsverzug)
- Bei einer fristlosen Kündigung informiert der Pflegedienst unverzüglich die zuständige Pflege- oder Krankenkasse.
Pflegegrad:
🩺 Was ist ein Pflegegrad?
Ein Pflegegrad beschreibt das Ausmaß der Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit eines Menschen und dient als Grundlage für Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung in Deutschland.
Seit der Reform der Pflegeversicherung im Jahr 2017 wurden die früheren Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Diese reichen von Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit) bis Pflegegrad 5 (schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung).
📊 Die Pflegegrade im Überblick
- Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die Pflege
Der Pflegegrad wird durch den Medizinischen Dienst (bei gesetzlich Versicherten) oder Medicproof (bei privat Versicherten) anhand eines standardisierten Begutachtungsverfahrens ermittelt. Dabei werden unter anderem Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhalten, Selbstversorgung und Alltagsleben beurteilt.
📌 Warum ist der Pflegegrad wichtig?
Der festgestellte Pflegegrad bestimmt, welche Leistungen und Zuschüsse pflegebedürftige Personen erhalten – z. B. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbeiträge oder Zuschüsse für Wohnraumanpassung.
Ein Antrag auf einen Pflegegrad kann bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden – oft formlos per Brief, E-Mail oder Online-Formular.
🔢 Wie viele Pflegegrade gibt es?
In Deutschland gibt es insgesamt fünf Pflegegrade. Diese wurden im Rahmen der Pflegereform 2017 eingeführt und ersetzen die früheren drei Pflegestufen. Die Pflegegrade spiegeln den Grad der Selbstständigkeit bzw. die Schwere der Pflegebedürftigkeit wider.
📊 Die fünf Pflegegrade im Überblick:
- Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
- Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
Die Einteilung in einen der fünf Pflegegrade erfolgt auf Basis eines Begutachtungsverfahrens, bei dem der Medizinische Dienst (MD) oder Medicproof (für Privatversicherte) verschiedene Lebensbereiche bewertet – z. B. Mobilität, geistige Fähigkeiten, Selbstversorgung und Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.
Je höher der Pflegegrad, desto umfangreicher sind die Leistungen der Pflegeversicherung, wie z. B. Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Unterstützung bei der Wohnraumanpassung oder Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.
📅 Wann erhält man einen Pflegegrad?
Einen Pflegegrad erhält man, wenn bei einer Person eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der <strongkörperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten vorliegt – und diese Einschränkungen voraussichtlich für mindestens sechs Monate bestehen.
📝 Voraussetzungen für einen Pflegegrad
- Ein formloser Antrag auf Pflegeleistungen wurde bei der zuständigen Pflegekasse gestellt
- Es wurde ein Begutachtungstermin durch den Medizinischen Dienst (bei gesetzlich Versicherten) oder durch Medicproof (bei privat Versicherten) durchgeführt
- Die Begutachtung hat ergeben, dass Hilfe im Alltag notwendig ist, etwa bei der Körperpflege, Ernährung, Mobilität oder Haushaltsführung
Die Gutachter bewerten in sechs Bereichen die Selbstständigkeit der betroffenen Person. Daraus ergibt sich ein Punktwert, der darüber entscheidet, welcher Pflegegrad zugewiesen wird – von Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung) bis Pflegegrad 5 (schwerste Beeinträchtigung mit besonderem Pflegebedarf).
⏱️ Wie lange dauert es bis zur Entscheidung?
Die Pflegekasse hat in der Regel drei Wochen Zeit, um nach Eingang des Antrags zu entscheiden. Wird ein Gutachten benötigt, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb der Frist, gilt der Antrag unter Umständen automatisch als genehmigt.
Tipp: Je ausführlicher der Antrag und die Angaben beim Begutachtungstermin sind, desto höher ist die Chance auf eine gerechte Einstufung.
📋 Wie kann man einen Pflegegrad beantragen?
Um einen Pflegegrad zu erhalten, muss ein Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden. Diese ist bei der jeweiligen Krankenkasse angesiedelt. Der Antrag kann formlos schriftlich, telefonisch oder auch online erfolgen.
Schritt-für-Schritt: Pflegegrad beantragen
- Pflegekasse kontaktieren: Wenden Sie sich telefonisch oder schriftlich an die Pflegekasse der pflegebedürftigen Person und stellen Sie den Antrag auf einen Pflegegrad.
- Antragsbestätigung abwarten: Die Pflegekasse schickt eine schriftliche Bestätigung und leitet den Vorgang an den Medizinischen Dienst (MD) bzw. Medicproof (für Privatversicherte) weiter.
- Begutachtungstermin vereinbaren: Ein Gutachter vereinbart einen Termin zur Untersuchung der Pflegebedürftigkeit – in der Regel zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung.
- Begutachtung erfolgt: Der Gutachter beurteilt die Selbstständigkeit der Person in sechs Lebensbereichen. Daraus ergibt sich ein Punktwert.
- Pflegegrad-Bescheid erhalten: Die Pflegekasse entscheidet auf Grundlage des Gutachtens und teilt den zugewiesenen Pflegegrad schriftlich mit.
⏱️ Fristen beachten
Die Pflegekasse hat in der Regel 3 Wochen Zeit zur Entscheidung – 5 Wochen, wenn ein Gutachten nötig ist. Erfolgt keine fristgerechte Rückmeldung, kann der Antrag unter bestimmten Voraussetzungen als genehmigt gelten.
📌 Wichtig:
- Der Antrag kann auch durch Angehörige oder Bevollmächtigte gestellt werden.
- Die Pflegebedürftigkeit muss voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.
- Je nach Pflegegrad ergeben sich unterschiedliche Leistungsansprüche wie Pflegegeld, Sachleistungen oder Entlastungsbeträge.
Pflegegeld und Leistungen:
💶 Was ist Pflegegeld?
Pflegegeld ist eine finanzielle Leistung der Pflegeversicherung, die pflegebedürftige Menschen erhalten, wenn sie im häuslichen Umfeld von Angehörigen, Freunden oder anderen ehrenamtlich tätigen Personen gepflegt werden. Es soll dazu beitragen, die häusliche Pflege zu ermöglichen und die Pflegeperson zu entlasten.
👥 Für wen ist Pflegegeld gedacht?
Pflegegeld richtet sich an Pflegebedürftige mit einem anerkannten Pflegegrad ab 2, die keine professionelle Pflegesachleistung in Anspruch nehmen, sondern sich zu Hause von privaten Pflegepersonen betreuen lassen.
💰 Höhe des Pflegegeldes nach Pflegegrad
| Pflegegrad | Pflegegeld pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 0 € (kein Anspruch auf Pflegegeld) |
| Pflegegrad 2 | 347 € |
| Pflegegrad 3 | 599 € |
| Pflegegrad 4 | 800 € |
| Pflegegrad 5 | 990 € |
📌 Voraussetzungen für den Erhalt von Pflegegeld
- Es muss ein anerkannter Pflegegrad (mindestens 2) vorliegen
- Die Pflege erfolgt im häuslichen Bereich durch eine private Pflegeperson
- Es wird keine professionelle Pflegesachleistung in Anspruch genommen (z. B. durch einen ambulanten Pflegedienst)
- Regelmäßige Beratungseinsätze nach §37 Abs. 3 SGB XI müssen durchgeführt werden
📞 Wie beantragt man Pflegegeld?
Der Antrag auf Pflegegeld erfolgt bei der zuständigen Pflegekasse. Er kann formlos gestellt werden, meist reicht ein kurzer Anruf oder ein schriftlicher Antrag. Nach der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (oder Medicproof bei Privatversicherten) wird ein Pflegegrad festgestellt, auf dessen Grundlage das Pflegegeld ausgezahlt wird.
✅ Wer hat Anspruch auf Pflegegeld?
Anspruch auf Pflegegeld haben Personen, die einen anerkannten Pflegegrad besitzen und im häuslichen Umfeld von einer privaten Pflegeperson versorgt werden – zum Beispiel durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn.
🧾 Voraussetzungen für den Anspruch auf Pflegegeld:
- Es liegt ein Pflegegrad von 2 bis 5 vor (Pflegegrad 1 ist nicht anspruchsberechtigt)
- Die Pflege findet zu Hause oder in einer Wohngemeinschaft statt
- Die pflegebedürftige Person wird nicht ausschließlich von einem Pflegedienst versorgt
- Regelmäßige Beratungsbesuche nach §37 Abs. 3 SGB XI werden nachgewiesen
👨👩👧👦 Wer gilt als private Pflegeperson?
Als Pflegepersonen gelten Menschen, die die pflegebedürftige Person regelmäßig und ehrenamtlich unterstützen – z. B. Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn. Es ist nicht erforderlich, eine pflegerische Ausbildung zu haben.
💡 Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombinieren?
Ja! Es ist möglich, Pflegegeld mit Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes zu kombinieren. In diesem Fall spricht man von Kombinationsleistungen. Das Pflegegeld wird anteilig gezahlt – je nachdem, wie viel der Pflege durch einen Dienst abgedeckt wird.
Berechnen Sie einfach Ihren Anspruch auf Pflegegeld bei Kombinationsleistungen
📞 Wie stellt man den Antrag?
Der Antrag auf Pflegegeld erfolgt über die Pflegekasse der Krankenkasse. Er kann telefonisch, schriftlich oder online gestellt werden. Nach einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof (bei Privatversicherten) wird über den Pflegegrad und damit den Anspruch auf Pflegegeld entschieden.
💶 Wie viel Pflegegeld steht mir zu?
Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad, den eine pflegebedürftige Person von der Pflegekasse anerkannt bekommen hat. Pflegegeld wird gezahlt, wenn die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige, Freunde oder ehrenamtliche Helfer erfolgt – also nicht durch einen professionellen Pflegedienst allein.
📊 Pflegegeld nach Pflegegrad (Stand: 2025)
| Pflegegrad | Pflegegeld pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 0 € (kein Anspruch) |
| Pflegegrad 2 | 347 € |
| Pflegegrad 3 | 599 € |
| Pflegegrad 4 | 800 € |
| Pflegegrad 5 | 990 € |
Hinweis: Die Beträge wurden zum 01.01.2025 angehoben. Bei Änderungen in der Gesetzgebung können sich die Beträge zukünftig weiter anpassen.
ℹ️ Was beeinflusst die Höhe des Pflegegeldes?
- Pflegegrad: Je höher der Pflegegrad, desto höher das Pflegegeld.
- Pflegeform: Pflegegeld gibt es nur bei häuslicher Pflege durch Laienpflegepersonen.
- Kombination mit Sachleistungen: Wird zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst in Anspruch genommen, reduziert sich das Pflegegeld anteilig (Kombinationsleistung).
📞 Pflegegeld beantragen
Sie können das Pflegegeld direkt bei Ihrer Pflegekasse beantragen. Voraussetzung ist ein bewilligter Pflegegrad ab Stufe 2. Den Antrag können Sie telefonisch, schriftlich oder online einreichen.
💰 Was sind Geldleistungen in der Pflege?
Geldleistungen in der Pflege sind finanzielle Unterstützungsleistungen, die von der Pflegekasse an pflegebedürftige Personen gezahlt werden, um die Versorgung im häuslichen Umfeld sicherzustellen. Die häufigste Form ist das Pflegegeld, das gezahlt wird, wenn die Pflege durch Angehörige, Freunde oder andere ehrenamtliche Helfer erfolgt – also nicht durch einen professionellen Pflegedienst allein.
🏠 Formen der Geldleistungen
- Pflegegeld: Monatliche Zahlung an Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5, wenn die Pflege im häuslichen Umfeld durch private Pflegepersonen erfolgt.
- Kombinationsleistung: Wenn ein Teil der Pflege durch Angehörige und ein Teil durch einen ambulanten Pflegedienst erfolgt, wird das Pflegegeld anteilig ausgezahlt.
- Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: Bis zu 4.180 € für Umbauten, die die häusliche Pflege erleichtern.
- Pflegehilfsmittel zum Verbrauch: Monatlicher Pauschalzuschuss (bis zu 40 €) für Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen u.v.m.
📌 Voraussetzungen für Geldleistungen
- Anerkannter Pflegegrad (mindestens Stufe 2)
- Pflege findet zu Hause oder in einer Wohngemeinschaft statt
- Pflege erfolgt durch eine nicht professionelle Pflegeperson
- Regelmäßige Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI (bei Pflegegeldbezug)
📞 Antragstellung
Geldleistungen müssen direkt bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Der Antrag kann telefonisch, schriftlich oder online gestellt werden. Die Höhe der Leistungen hängt vom anerkannten Pflegegrad ab.
Tipp: Lassen Sie sich bei der Antragstellung von einer Pflegeberatungsstelle unterstützen – das erhöht Ihre Chancen auf eine schnelle Bewilligung.
🔄 Was sind Kombinationsleistungen bzw. Kombinationspflege?
Die Kombinationspflege – auch als Kombinationsleistung bezeichnet – ist eine besondere Leistungsform der gesetzlichen Pflegeversicherung. Sie ermöglicht es Pflegebedürftigen, Pflegesachleistungen (z. B. durch einen ambulanten Pflegedienst) und Pflegegeld (z. B. für die Pflege durch Angehörige) flexibel miteinander zu kombinieren.
✅ Voraussetzungen für Kombinationsleistungen
- Ein Pflegegrad ab Stufe 2 ist vorhanden
- Die Pflege erfolgt teilweise durch einen Pflegedienst (Sachleistung)
- Und teilweise durch Angehörige oder Freunde (Pflegegeld)
💡 Wie funktioniert die Kombinationspflege?
Wenn Sie nicht den vollen Betrag der Pflegesachleistung nutzen, haben Sie Anspruch auf anteiliges Pflegegeld. Die Pflegekasse zahlt dann einen bestimmten Prozentsatz des Pflegegeldes entsprechend dem Anteil der ungenutzten Sachleistungen.
📊 Beispiel:
Wird nur 60 % der Sachleistung beansprucht, erhalten Sie zusätzlich 40 % des Pflegegeldes.
📌 Vorteile der Kombinationsleistung
- Mehr Flexibilität in der häuslichen Pflege
- Pflegedienst übernimmt professionelle Aufgaben
- Angehörige bleiben aktiv eingebunden
- Nicht genutzte Leistungen verfallen nicht, sondern werden anteilig vergütet
📝 Antragstellung
Kombinationsleistungen müssen bei der Pflegekasse beantragt werden. Dabei muss die prozentuale Aufteilung zwischen Sachleistung und Pflegegeld angegeben werden. Die Abrechnung erfolgt monatlich.
Tipp: Eine Pflegeberatung kann helfen, das ideale Verhältnis zwischen Pflegegeld und Sachleistung für Ihre individuelle Pflegesituation zu ermitteln.
🏠 Was sind Sachleistungen in der häuslichen Pflege?
Sachleistungen in der häuslichen Pflege sind professionelle Pflegeleistungen, die von einem anerkannten ambulanten Pflegedienst erbracht und direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn Pflegebedürftige zu Hause gepflegt werden und Unterstützung durch geschultes Pflegepersonal benötigen.
💡 Was umfasst die Pflegesachleistung?
Die Leistungen umfassen unter anderem:
- Körperbezogene Pflegemaßnahmen (z. B. Hilfe beim Waschen, Ankleiden, Toilettengang)
- Medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung (z. B. Medikamentengabe, Verbandswechsel, Insulingabe)
- Unterstützung im Haushalt (z. B. Einkaufen, Kochen, Reinigen)
- Pflegeeinsätze zur Sicherung der häuslichen Pflege
📊 Höhe der Sachleistungen nach Pflegegrad
| Pflegegrad | Max. monatliche Sachleistung |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | Keine Sachleistung, nur Entlastungsbetrag (131 €) |
| Pflegegrad 2 | 796 € |
| Pflegegrad 3 | 1.497 € |
| Pflegegrad 4 | 1.859 € |
| Pflegegrad 5 | 2.299 € |
📌 Wer hat Anspruch auf Sachleistungen?
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5
- Pflege findet zu Hause oder in einer ambulant betreuten Wohngruppe statt
- Die Pflege erfolgt durch einen zugelassenen Pflegedienst
📝 Antragstellung
Sachleistungen müssen bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Nach Bewilligung rechnet der Pflegedienst direkt mit der Pflegeversicherung ab – es entsteht kein finanzieller Aufwand für den Pflegebedürftigen, solange der Höchstbetrag nicht überschritten wird.
Tipp: Sachleistungen können auch mit Pflegegeld kombiniert werden – das nennt man Kombinationspflege.
📝 Die Umstellung von Pflegegeld auf Pflegesachleistungen
Die Umstellung von Pflegegeld auf Sachleistungen ist unkompliziert und kann formlos per Telefon bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Nach Eingang des Antrags beginnt die Bearbeitung, die abhängig von Pflegekasse und Pflegedienst in der Regel 2 bis 3 Monate dauern kann. Im Anschluss erfolgt die Rückerstattung rückwirkend, und offene Beträge werden anteilig in regelmäßigen Abständen ausgezahlt.
Beratungseinsatz:
❓ Was ist ein Beratungseinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI?
Der Beratungseinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI ist ein regelmäßiger Hausbesuch durch eine geschulte Pflegefachkraft oder eine anerkannte Beratungsstelle. Er dient dazu, die häusliche Pflege zu unterstützen und die Qualität der Versorgung sicherzustellen.🎯 Ziel und Inhalte
- Überprüfung der Pflegesituation und Beratung der Pflegeperson
- Schulung zu Pflegetechniken, Dekubitus-, Sturz- und Infektionsprophylaxe
- Empfehlungen zu Pflegehilfsmitteln und Wohnraumanpassung
- Unterstützung beim Umgang mit Medikamenten und ärztlichen Verordnungen
- Aufzeigen von Entlastungs- und Unterstützungsangeboten
📅 Häufigkeit gemäß AOK
- Pflegegrad 2 & 3: halbjährliche Beratungseinsätze
- Pflegegrad 4 & 5: vierteljährliche Beratungseinsätze
📝 Wer führt den Einsatz durch?
Der Einsatz wird von einer qualifizierten Pflegefachkraft des ambulanten Pflegedienstes oder einer unabhängigen Beratungsstelle durchgeführt. Er ist für alle Pflegegeldempfänger Pflicht, um den Bezug von Pflegegeld weiterhin zu gewährleisten.
📅 Wie oft muss ein Beratungseinsatz durchgeführt werden?
Ein Beratungseinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI ist für alle Pflegegeldempfänger verpflichtend und muss in folgenden Intervallen stattfinden:
- Pflegegrad 1: einmal jährlich
- Pflegegrad 2 & 3: alle sechs Monate (halbjährlich)
- Pflegegrad 4 & 5: alle drei Monate (vierteljährlich)
Diese regelmäßigen Hausbesuche durch eine qualifizierte Pflegefachkraft oder anerkannte Beratungsstelle stellen sicher, dass die häusliche Pflege fachgerecht umgesetzt wird und Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen optimal unterstützt werden.
📋 Wie oft benötigen Pflegegeldbezieher eine Bestätigung für die Pflegekasse?
Pflegegeldempfänger müssen den regelmäßigen Beratungsbesuch (§ 37 Abs. 3 SGB XI) gegenüber der Pflegekasse nachweisen. Die Bescheinigung darüber ist in folgenden Intervallen einzureichen:
- Pflegegrad 1: einmal jährlich
- Pflegegrad 2 & 3: alle sechs Monate
- Pflegegrad 4 & 5: alle drei Monate
Ohne rechtzeitige Vorlage der Bestätigung kann die Pflegekasse die Auszahlung des Pflegegeldes aussetzen.
Behandlung und Verhinderungspflege:
🏥 Was ist Behandlungspflege?
Behandlungspflege umfasst medizinisch-pflegerische Maßnahmen, die auf ärztliche Verordnung hin von examiniertem Pflegepersonal durchgeführt werden. Sie wird nach § 37 SGB V von der Krankenkasse übernommen und dient der Behandlung oder Vermeidung von Krankheitsfolgen.
💉 Beispiele für Behandlungspflege:
- Medikamentengabe (z. B. Injektionen, orale Verordnung)
- Wundversorgung und Verbandwechsel
- Blutzuckermessung und Insulingabe bei Diabetes
- Anlegen und Wechseln von Kathetern
- Stoma- und PEG-Versorgung
📋 Voraussetzungen & Kostenträger
- Ärztliche Verordnung (Heil- und Hilfsmittelverordnung)
- Durchführung durch qualifiziertes Pflegefachpersonal
- Abrechnung über die Krankenkasse (SGB V)
Behandlungspflege ergänzt die häusliche bzw. ambulante Pflege und stellt sicher, dass medizinische Maßnahmen fachgerecht ausgeführt werden.
📝 Wie kann man Behandlungspflege beantragen?
Behandlungspflege nach § 37 SGB V wird auf ärztliche Verordnung durch die Krankenkasse übernommen. So gehen Sie dabei vor:
- Ärztliche Verordnung einholen:
Bitten Sie Ihren Arzt, für die benötigten Maßnahmen (z. B. Injektionen, Wundversorgung) eine Verordnung der häuslichen Krankenpflege auszustellen. - Pflegedienst auswählen:
Wählen Sie einen ambulanten Pflegedienst, der Behandlungspflege anbietet, oder lassen Sie sich von Ihrer Krankenkasse Empfehlungen geben. - Verordnung einreichen:
Reichen Sie die ärztliche Verordnung beim Pflegedienst und bei Ihrer Krankenkasse ein. - Genehmigung abwarten:
Die Krankenkasse prüft die Verordnung und sendet Ihnen einen schriftlichen Bewilligungsbescheid zu. - Termine vereinbaren:
Nach Genehmigung vereinbaren Sie mit dem Pflegedienst die konkreten Pflegeeinsätze.
Nach Bewilligung übernimmt die Krankenkasse die Kosten und rechnet direkt mit dem Pflegedienst ab.
🩺 Was versteht man unter einer ärztlichen Verordnung (VO)?
Eine ärztliche Verordnung (VO) ist ein schriftliches Dokument, das ein Arzt oder eine Ärztin ausstellt, um medizinische Leistungen, Heil- und Hilfsmittel oder Pflegeleistungen zu verordnen. Sie bildet die rechtliche Grundlage für die Kostenübernahme durch Krankenkassen oder Pflegekassen.
📑 Inhalte einer Verordnung
- Patientendaten: Name, Geburtsdatum und Versicherungsnummer
- Diagnose oder Therapeutikum: medizinischer Befund oder Behandlungsziel
- Leistungsumfang: Art der Maßnahme (z. B. Wundversorgung, Physiotherapie, Pflegehilfe)
- Dauer und Häufigkeit: Anzahl der Anwendungen und Zeitraum
- Verordnender Arzt: Stempel, Unterschrift und Datum
✅ Bedeutung für Patienten und Leistungserbringer
- Ermöglicht die Abrechnung mit Krankenkasse oder Pflegekasse
- Gewährleistet, dass notwendige Therapien und Hilfsmittel fachgerecht eingesetzt werden
- Dient als Nachweis für den Behandlungsbedarf gegenüber Kostenträgern
🔍 Wozu dient eine ärztliche Verordnung?
Eine ärztliche Verordnung (VO) ist die offizielle Anordnung eines Arztes, um medizinische Maßnahmen, Pflegeleistungen oder Hilfsmittel zu erhalten. Sie stellt sicher, dass die Kostenübernahme durch Krankenkassen und Pflegekassen rechtlich abgesichert ist.
💡 Hauptfunktionen einer Verordnung
- Kostenzusage: Basis für die Erstattung therapeutischer Leistungen (z. B. Physio- oder Ergotherapie).
- Hilfsmittelbereitstellung: Grundlage für den Bezug von Pflegeutensilien und technischen Geräten (Rollatoren, Inhalatoren).
- Pflegeeinsätze: Ermächtigt ambulante Pflegedienste zur Durchführung fachlicher Pflege nach SGB V oder SGB XI.
- Medikamentenverordnung: Legitimiert die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel in der Apotheke.
✅ Warum ist sie unverzichtbar?
- Sichert eine reibungslosen Abrechnung mit den Kostenträgern.
- Garantiert, dass nur medizinisch notwendige Leistungen erbracht werden.
- Dient als Nachweis für den tatsächlichen Behandlungs- oder Versorgungsbedarf.
Entlastungsleistungen:
🛡️ Was sind Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI?
Entlastungsleistungen gemäß § 45b SGB XI sind ergänzende Unterstützungsangebote für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. Sie dienen dazu, den Pflegealltag zu erleichtern und Betroffene vor Überlastung zu schützen.
🔹 Wer kann Entlastungsleistungen nutzen?
- Versicherte mit Pflegegrad 1 bis 5
- Empfänger von Pflegegeld oder Pflegesachleistungen
🔹 Welche Leistungen sind förderfähig?
- Haushaltsnahe Dienste (Einkauf, Reinigung, Wäschepflege)
- Begleitung zu Arztbesuchen oder Spaziergängen
- Betreuungsangebote für Demenzkranke (Tagespflege, Betreuungsgruppen)
- Sachleistungsorientierte Entlastung (z. B. einfache Hilfsmittel)
🔹 Höhe und Verwendung des Budgets
Anspruchsberechtigte erhalten bis zu 131 € pro Monat (ab dem 01.01.2025), die flexibel für oben genannte Angebote eingesetzt werden können. Nicht genutzte Beträge verfallen am Monatsende.
🔹 Antragstellung
- Kontakt zur Pflegekasse aufnehmen
- Entlastungsbedarf schildern
- Leistungsnachweise (Rechnungen, Belege) einreichen
- Auszahlung oder direkte Abrechnung mit Dienstleistern
Entlastungsleistungen unterstützen Pflegende im Alltag und helfen, Pflegebedürftigen mehr Teilhabe und Lebensqualität zu ermöglichen.
💶 Was versteht man unter dem Entlastungsbetrag?
Der Entlastungsbetrag ist eine monatliche Pauschale in Höhe von bis zu 131 €, die Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zur Verfügung steht. Er dient dazu, professionelle oder ehrenamtliche Unterstützungsangebote im Alltag zu finanzieren und pflegende Angehörige zu entlasten.
🔹 Wer ist anspruchsberechtigt?
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5
- Leistungsbezieher von Pflegegeld oder Pflegesachleistungen
🔹 Welche Leistungen können damit bezahlt werden?
- Haushaltsnahe Dienste (z. B. Reinigung, Wäschepflege)
- Begleitung zu Arztterminen und Behördengängen
- Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz
- Hauswirtschaftliche Versorgung (Einkauf, Kochen)
🔹 So beantragen Sie den Entlastungsbetrag
- Kontakt mit Ihrer Pflegekasse aufnehmen
- Entlastungsbedarf schildern und Dienstleister benennen
- Rechnungen oder Belege bei der Pflegekasse einreichen
Nicht genutzte Beträge verfallen am Monatsende. Der Entlastungsbetrag verbessert die Lebensqualität und bietet Flexibilität bei der Organisation der häuslichen Versorgung.
👥 Wer kann Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI nutzen?
Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI stehen Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen zur Verfügung, um den Pflegealltag zu vereinfachen und Überlastung vorzubeugen.
✅ Anspruchsberechtigte Personengruppen
- Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad 1–5
- Bezieher von Pflegegeld oder Pflegesachleistungen
- Personen, die zuhause oder in einer ambulant betreuten WG gepflegt werden
🔍 Welche Bedingungen gelten?
- Leistungen müssen im Rahmen eines monatlichen Budgets (bis zu 131 €) abgerufen werden
- Kann flexibel für haushaltsnahe Dienste, Betreuungsangebote oder Begleitungen eingesetzt werden
- Erstantrag erfolgt bei der zuständigen Pflegekasse
Durch die Kombination verschiedener Unterstützungsangebote verbessern Entlastungsleistungen die Lebensqualität von Pflegebedürftigen und schützen pflegende Angehörige vor Überlastung.
🏠 Entlastungsleistungen nach § 45b
Entlastungsleistungen müssen nicht ausschließlich von ambulanten Pflegediensten erbracht werden. Folgende Anbieter sind ebenfalls zugelassen:
- Zugelassene ambulante Pflegedienste (Betreuungs- und Entlastungsangebote)
- Anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, z. B. Betreuungsgruppen oder Tagespflege
- Private Nachbarschaftshilfe, wenn die Helferinnen und Helfer einen von der Pflegekasse anerkannten Schulungskurs absolviert haben
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Einkauf, Reinigung, Begleitung)
Durch diese Vielfalt an Leistungserbringern wird gewährleistet, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen flexibel passende Unterstützungsangebote nutzen können – unabhängig vom ambulanten Pflegedienst.
Verhinderungspflege:
⏸️ Was versteht man unter Verhinderungspflege?
Verhinderungspflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung (§ 39 SGB XI), die einspringt, wenn die reguläre Pflegeperson (z. B. Angehörige) vorübergehend ausfällt – etwa wegen Krankheit, Urlaub oder anderen Verhinderungsgründen.
🔹 Wer hat Anspruch?
- Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2
- Die häusliche Pflege muss seit mindestens sechs Monaten durch eine private Pflegeperson erfolgen
🔹 Umfang und Dauer
- Bis zu 6 Wochen (42 Tage) pro Kalenderjahr
- Maximal 1.612 € Kostenerstattung pro Jahr
- Kombinierbar mit Kurzzeitpflege (bis zu 806 € zusätzlich)
- Ab dem 1. Juli 2025 beträgt das zusammengefasste Entlastungsbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 3.539 €
🔹 Leistungen im Rahmen der Verhinderungspflege
- Einsatz eines ambulanten Pflegedienstes
- Stundenweise Betreuung durch geeignete Ersatzpflegepersonen (z. B. Nachbarn)
- Unterkunft und Verpflegung der Ersatzpflegekraft (falls erforderlich)
🔹 Antragstellung
- Kontakt mit der zuständigen Pflegekasse aufnehmen
- Voraussetzungen prüfen (Pflegegrad, Vorpflegezeit)
- Antragsformular ausfüllen und einreichen
- Rechnungen oder Nachweise nach Einsatzabrechnung bei der Pflegekasse einreichen
Verhinderungspflege schützt pflegende Angehörige vor Überlastung und garantiert kontinuierliche Versorgung, selbst wenn Hauptpflegepersonen kurzfristig ausfallen.
✅ Wer kann Verhinderungspflege in Anspruch nehmen?
Verhinderungspflege ist eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung, die einspringt, wenn die reguläre Betreuungsperson vorübergehend ausfällt. Anspruchsberechtigt sind Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen unter folgenden Voraussetzungen:
📝 Grundvoraussetzungen
- Ein anerkannter Pflegegrad ab Stufe 2
- Mindestens sechs Monate regelmäßige häusliche Pflege durch eine private Person
- Die Ersatzpflege übernimmt für maximal 6 Wochen (42 Tage) pro Kalenderjahr
👥 Wer zählt als Pflegeperson?
- Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die üblicherweise die Pflege übernehmen
- Gesetzlich anerkannte Ersatzpflegekräfte oder ambulante Pflegedienste
💡 Weitere wichtige Hinweise
- Die Pflegekasse übernimmt bis zu 1.612 € pro Jahr für Ersatzpflege. Ab dem 1. Juli 2025 beträgt das zusammengefasste Entlastungsbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 3.539 €
- Nicht genutzte Beträge können für Kurzzeitpflege angerechnet werden
- Rechnungen und Nachweise müssen bei der Pflegekasse eingereicht werden
Mit der Verhinderungspflege stellt die Pflegeversicherung sicher, dass pflegende Angehörige entlastet werden und die häusliche Versorgung auch in Abwesenheit der Hauptpflegeperson fortbesteht.
💰 Wie hoch ist der Zuschuss bei Verhinderungspflege?
Im Rahmen der Verhinderungspflege erstattet die Pflegekasse die Kosten für die Ersatzpflege, wenn die reguläre Betreuungsperson verhindert ist. Die Höhe der möglichen Auszahlung richtet sich nach gesetzlichen Vorgaben.
🔹 Grundbetrag pro Kalenderjahr
- Bis zu 1.612 € für Ersatzpflege durch professionelle oder private Pflegepersonen
- Gilt für maximal 6 Wochen (42 Tage) Ersatzpflege
🔹 Kombination mit Kurzzeitpflege
Nicht genutzte Mittel aus der Kurzzeitpflege können teilweise für Verhinderungspflege verwendet werden:
- Zuschuss für Kurzzeitpflege bis zu 806 € (50 % des Jahresbetrags von 1.612 €)
- Somit lassen sich insgesamt bis zu 2.418 € pro Jahr abrufen
- Ab dem 1. Juli 2025 beträgt das zusammengefasste Entlastungsbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 3.539 €
🔹 Voraussetzungen für die Kostenerstattung
- Anerkannter Pflegegrad 2–5
- Vorher mindestens sechs Monate häusliche Pflege
- Nachweis der Ersatzpflegeleistungen (Rechnungen, Quittungen)
Der Verhinderungspflege-Zuschuss entlastet pflegende Angehörige und sichert die kontinuierliche Versorgung auch bei Urlaub oder Krankheit der Hauptpflegeperson.
Finanzierung:
📊 Investitionskosten im Pflegedienst: Was zählt dazu?
Für ambulante und stationäre Pflegedienste umfassen Investitionskosten alle Ausgaben, die für die Anschaffung, Installation und Instandhaltung langfristiger Betriebs- und Pflegeeinrichtungen anfallen. Diese Kosten fließen in die Kalkulation der Pflegesätze ein und können über Gebührenordnungen oder individuelle Pflegeverträge an Kunden weitergegeben werden.🔹 Beispiele für Investitionskosten im Pflegebereich
- Mobile Pflegeausstattung: Behandlungswagen, Rollstühle, Pflegebetten
- Medizinische Geräte: Blutdruckmessgeräte, Infusionspumpen, Beatmungsgeräte
- IT-Infrastruktur: Dokumentationssoftware, Tablets, Serversysteme
- Fahrzeuge: Pflegefahrzeuge, Transportbusse
- Gebäudetechnik: barrierefreie Umbauten, Notrufsysteme, Elektrik
📑 Rechtsgrundlage für die Kostenerstattung
- Pflegesatzvereinbarung: Investitionskosten sind Bestandteil der von Pflegekassen genehmigten Pflegesätze (SGB XI, § 89).
- Vertragliche Regelung: Bei Privatkunden werden Investitionskosten im individuellen Leistungs- und Pflegevertrag ausgewiesen.
- Abschreibung nach HGB: Anschaffungskosten werden über die Nutzungsdauer verteilt und als jährlicher Abschreibungsanteil berechnet.
✅ Transparente Abrechnung
Kunden erhalten entweder über die Pflegekasse eine Erstattung im Rahmen der vereinbarten Pflegesätze oder bei Privatverträgen eine detaillierte Rechnung, in der der Anteil der Investitionskosten separat ausgewiesen und über die Nutzungsdauer anteilig berechnet wird.📜 Gesetzliche Grundlagen für Kassenkunden
- SGB XI § 75 und § 89: Pflegesätze der Pflegekassen müssen alle Kosten – inklusive Investitionskosten – vollständig abdecken.
- Pflegesatzvereinbarungsverordnung: Investitionskosten sind Teil des mit den Landesverbänden vereinbarten Preises und können nicht separat ausgewiesen werden.
🤝 Abrechnung bei Privatkunden
- BGB-Vertrag: Investitionskosten können im Pflegevertrag als zusätzlicher Posten vereinbart werden.
- BGB § 305 ff. (AGB-Recht): Bei vorformulierten Vertragsbedingungen müssen Transparenz- und Angemessenheitsregeln beachtet werden.
- HGB § 253 (Abschreibung): Anschaffungskosten sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer anteilig abzuschreiben und als jährlicher Kostenanteil auszuweisen.
Fazit: Für gesetzlich Versicherte sind Investitionskosten bereits in den Pflegesätzen enthalten. Nur bei Privatverträgen können Pflegedienste diese Kosten zusätzlich geltend machen – basierend auf einer klaren vertraglichen Vereinbarung und unter Beachtung des AGB-Rechts.
Die gesetzliche Regelung ergibt sich zusätzlich aus dem §82 Absatz 4 SGB XI.
In der Regel übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für ärztlich verordnete häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V. Allerdings fällt eine gesetzlich geregelte Zuzahlung an.
💶 Höhe der Zuzahlung
- 10 % der Kosten der häuslichen Krankenpflege
- mindestens 5 € und höchstens 10 € je Verordnung
👥 Wer ist befreit?
- Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
- Schwerbehinderte (mit Befreiungsmerkmal H oder Bl) und Empfänger von Sozialhilfe
- Schwangere und Wöchnerinnen (häusliche Pflege in Schwangerschaft und Wochenbett)
📜 Gesetzliche Grundlage
Die Zuzahlung ist geregelt in § 61 SGB V („Zuzahlungen der Versicherten“). Bei jeder Verordnung zur häuslichen Krankenpflege müssen Sie die Zuzahlung direkt an den Pflegedienst leisten.
Erfahren Sie mehr über Zuzahlung bei der häuslichen Krankenpflege
Jetzt kostenlose Pflegeberatung in Hessen (Beratungseinsatz nach §37. SGB XI) anfragen
Erfüllen Sie Ihre gesetzliche Pflichtberatung ganz einfach – wir helfen Ihnen schnell, professionell und kostenlos. Auch online möglich!
Jetzt Termin vereinbaren und Pflegegeld sichern!